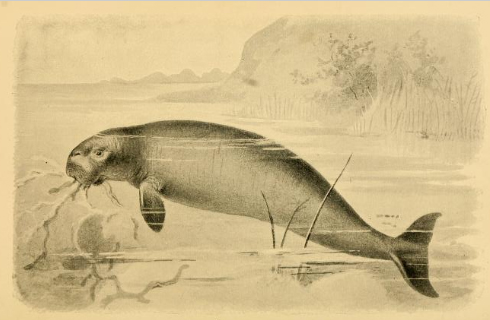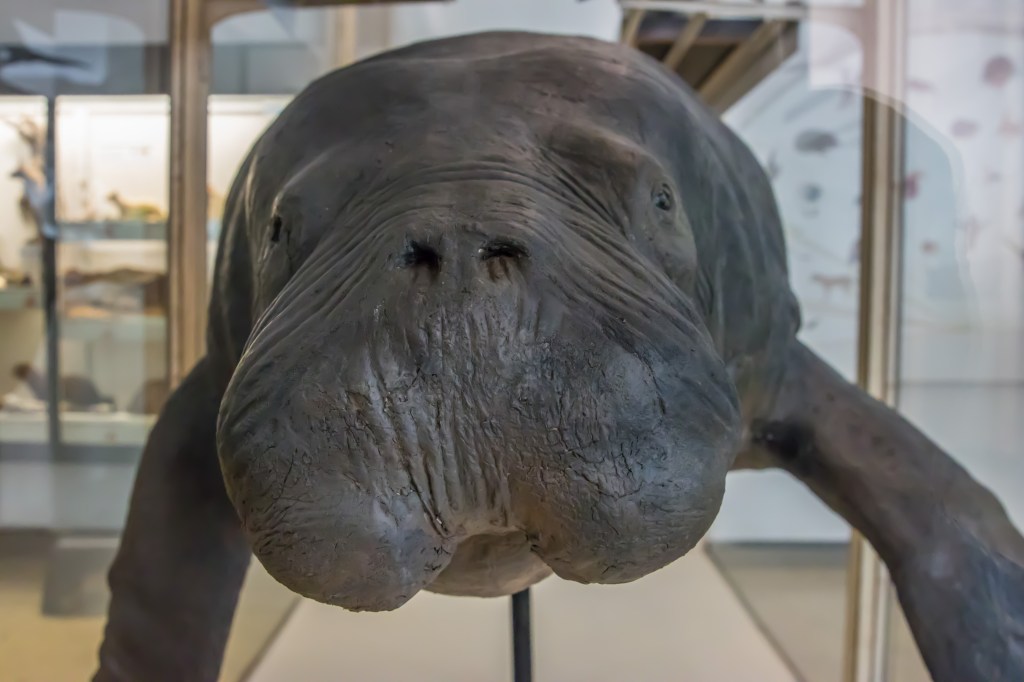Der Name „Dschelada“ für diese Affenart – die lat. Bezeichnung lautet „Theropithecus gelada“- hat seinen Ursprung im Amharischen, der Sprache Äthiopiens. Er leitet sich vom Wort „Gelada“ ab, was so viel wie „Affe“ oder „Meerkatze“ bedeutet. Außer der üblichen Vorstellung dieser Tierart möchte ich etwas ausführlicher über das soziale Miteinander bzw. den Aufbau der Dschelada – Gruppen erzählen. Wie für viele andere Tierarten, hat es sich auch für die Dscheladas im Laufe ihrer Evolution von Vorteil erwiesen, in Gruppen zu leben.
Aber beginnen wir mit der deutschen Bezeichnung „Blutbrustpavian“. Ein etwas seltsamer Name, der seinen Ursprung vom nackten Brustbereich der Tiere hat. Zur Fortpflanzungszeit oder bei starker Erregung färbt sich dieser rot. Die Art gehört zur Familie der Meerkatzenartigen, wie die Paviane auch. Allerdings haben Dscheladas und Paviane zwar gemeinsame Vorfahren, Dscheladas sind jedoch keine Paviane. Sie sind ihre nächsten Verwandten. Während Paviane in vielen Ländern Afrikas weit verbreitet sind, findet man Dscheladas ausschließlich im Hochland von Äthiopien.Prof. Grzimek nennt die Tiere in seinem „Tierleben“ (Säugetiere 1) deshalb Hochgebirgsaffen.
Um deren Lebensweise besser zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Geographie Äthiopiens. Das „Hochland von Abessinien“ zieht sich vom Norden bis in den Süden. Mehr als die Hälfte des Landes liegt über 1200 m hoch. Ein Teil dieses Hochlandes und die letzte verbliebene Heimat der Dscheladas, ist das Amhara-Plateau. Es fällt von 4500 m (der höchste Berg Ras-Dejen) bis auf etwa 2000 m nach Süden ab. Hier liegt auch ganz im Norden der größte Nationalpark und Weltkulturerbe der Simien-Nationalpark. Das Hochland wird zerschnitten durch zahlreiche Flüsse wie dem Weißen Nil, die tiefe Canyons und Täler mit steilen Abbruchkanten bilden. Das Klima in den niedrigeren Regionen des Plateaus ist durchaus mediterran, geht aber mit zunehmender Höhe in Hochgebirgsklima über. Die Landschaft wechselt mit zunehmender Höhe von einer nahezu baumlosen Graslandschaft in eine alpine Felslandschaft.
Die Dscheladas haben sich diesen Bedingungen perfekt angepasst. Abends ziehen sie sich in die höher gelegenen Felsformationen zurück, um dort die Nacht zu verbringen. Am Morgen lassen sie sich auf den Felsen ruhend von der Sonne erwärmen, um dann gemeinsam in die weiter unten gelegenen Plateaus mit ihren Graslandschaften zur Nahrungsaufnahme zu wechseln. Diese besteht zum überwiegenden Teil aus Gras. In Trockenzeiten sind sie jedoch durchaus flexibel und nehmen auch Wurzeln, Früchte, Knollen, Kräutern oder Insekten auf.







Dscheladas leben in Gruppen unterschiedlicher Größe zusammen. Diese Gruppen und Untergruppen erhielten folgende wissenschaftliche Namen:
- Die Ein-Mann-Haremsgruppe oder „One-Male-Unit“ – Es ist praktisch eine Familiengruppe aus 1-10 weiblichen Tieren mit den noch nicht erwachsenen Nachkommen. Angeführt wird die One-Male-Unit erwartungsgemäß von einem Alphamännchen. Löst ein erwachsenes männliches Tier ein anderes (evtl. zu altes) ab, so verbleibt dieses meist in der Gruppe, geht dem neuen Chef aus dem Weg und pflegt seinen Sozialkontakt (ohne Sexualkontakt) zu einem der Weibchen weiterhin.
- Da geschlechtsreife Männchen den Familienverband mit etwa 5-6 Jahren verlassen müssen, schließen sie sich zu Junggesellengruppen zusammen, die dann „All-Male-Units“ genannt werden. Nun schließen sich diesen Gruppen aus Erwachsenen auch Untergruppen aus Jugendlichen an, die oft zwischen der 1. und 2. beschriebenen Gruppe hin und herwechseln und mit ihren Müttern weiterhin Kontakt pflegen.
- Daraus folgt, dass sich beide Gruppen verwandtschaftlich nahestehen und sich ein Territorium teilen. Man nennt daher die Verbindung der Gruppen 1 und 2 ein „Team“. Hin und wieder versuchen sich geschlechtsreife Männchen aus Teams der One-Male-Unit anzuschließen, man nennt sie dann „Follower“. Follower leben am Rand der Gruppe versuchen aber zu gegebener Zeit das Alphatier abzulösen oder mit einer der Damen durchzubrennen um eine eigene One-Male-Unit zu gründen. Sie verteidigen allerdings auch gemeinsam mit dem Haremsführer die Gruppe gegen Eindringlinge wie z.B. solitär lebenden Männchen (Einzelgänger) oder Feinde.
- Mehrere Teams können „Bands“ (deutsch – Banden) bilden. Diese teilen sich dann ein Verbreitungsgebiet und nutzen gemeinsam Futterplätze und Wasserstellen. Außerdem gehen Forscher davon aus, dass es durch die fortlaufende Aufspaltung der Gruppen und damit Neubildung von One-Male-Units starke verwandtschaftliche Beziehungen innerhalb dieser Bands gibt. Die Bands bilden sich aus 30 – 260 Einzeltieren. Bands trennen sich bei knapp werdenden Nahrungsressourcen und kommen zusammen sobald sich die Situation verbessert.
- Die größte Einheit in der sozialen Gemeinschaft bilden die dynamischen „Herds“ (Herden). Zusammensetzung und Größe ändern sich permanent und entstehen durch überlappende Reviere. Man konnte bis zu 600 Tiere in einer Herde zählen.





Verschiedene Drohgebärden des Alphamännchens: Mitte oben – starkes drohen und „Reproduktion“
Man kann also festhalten, dass die Haremsgruppe die wichtigste Konstante im sozialen Miteinander bei Dscheladas ist. Und hier sind es die Weibchen, die für stabile Verhältnisse in der Gruppe sorgen. Die ranghöheren Weibchen bleiben lebenslang in ihrer Geburtsgruppe und pflegen enge Kontakte überwiegend mit anderen Weibchen und nicht mit dem Haremsführer. Dieser hat eigentlich folgende funktionen: die Gruppe nach außen zu verteidigen, Streitigkeiten innerhalb der Gruppe zu unterbinden und, wie es biologisch so schön heißt, für Reproduktion zu sorgen. Wobei man festhalten kann, dass zwar das Männchen den Anstoß für den Zeugungsakt gibt, aber die Weibchen entscheiden, ob es dazu kommt oder nicht. Dominante Weibchen werden häufiger gedeckt als rangniedrigere.
Sollte es zu einer Übernahme des Harems durch einen Einzelgänger oder Follower kommen, genügt es nicht das Alphamännchen zu besiegen. Auch hier sind es die Weibchen die letztendlich den neuen „Chef“ akzeptieren oder nicht.
Eigentlich sind Dscheladas sehr ruhige und bedachte Tiere. Streitigkeiten sind aber in einer Gruppe unvermeidlich. Das Alphamännchen beendet diese jedoch meist mit seiner beeindruckenden Präsenz und einer kurzen Verfolgungsjagd. Das gute Miteinander und die Verbundenheit einzelner Tiere untereinander, spielt eine sehr wichtige Rolle. Das sogenannte „Grooming“ (Fellpflege) festigt die Gemeinschaft. Das bei uns gebräuchliche Wort „Lausen“ trifft es allerdings nicht, da nicht immer Insekten und Schmutz entfernt werden, sondern das Fell auf diese Weise gepflegt wird. Pflegen die Tiere ihr eigenes Fell, dient dies häufig zur Beruhigung z.B. nach einem Streit.
Die anspruchsvolle Sozialstruktur dieser Tiere macht die Haltung von Dscheladas für Zoos nicht eben einfach. Im deutschsprachigen Raum gibt es 8 Haltungen von denen der Naturzoo in Rheine die größte Anzahl Dscheladas in vier Haremsgruppen hält und das europäische Zuchtbucht führt. Dort und in der Wilhelma werden sie zusammen mit Mähnenspringern auf einer Anlage gehalten. In der Natur bilden sie häufig Lebensgemeinschaften mit Walia-Steinböcken, die in Zoos jedoch nicht gehalten werden.



Mähnenspringer und Dscheladas in der Wilhelma Stuttgart
Die instabile politische Lage in Äthiopien sowie die prekäre wirtschaftliche Situation der dort lebenden Menschen führen dazu, dass Auswilderungen momentan nicht möglich sind und die Bestände durch den kleiner werdenden Lebensraum abnehmen.
Für uns Besserwisser:
In der Zoologie werden Tiere in drei Entwicklungsstufen eingeteilt –
juvenil = jugendlich,
Sub adult = praktisch erwachsen aber noch nicht fortpflanzungsfähig
adult = erwachsen und fortpflanzungsfähig





Alle Bilder dieses Beitrags entstanden in der Wilhelma Stuttgart und im Naturzoo Rheine